Abteilung Fischökologie & Evolution
Die dynamischen Auengebiete bieten Lebensräume für eine hohe Artenvielfalt. Lange Zeit blieb unerkannt, dass Bartgrundeln (Barbatula), Groppen (Cottus) und Elritzen (Phoxinus) sogenannte Artkomplexe sind, die jeweils mehrere Arten mit unterschiedlichen Lebensraumansprüchen umfassen.
Die Schweizer Gewässer beherbergen eine aussergewöhnlich hohe biologische Vielfalt. Der zunehmende gesellschaftliche Druck auf das Klima und die natürlichen Ökosysteme führt jedoch zu einem noch nie dagewesenen Verlust an Biodiversität, insbesondere in Seen und Flüssen. Die ökologischen Folgen dieses Rückgangs werden nach wie vor weitgehend unterschätzt, und die Umsetzung von Schutzmassnahmen steht vor grossen Herausforderungen, da sie mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Einschränkungen in Einklang gebracht werden müssen. Das LANAT-3-Projekt zielt darauf ab, das Wissen über die aquatische Artenvielfalt zu verbessern, um ihre Erhaltung und Wiederherstellung zu unterstützen und gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel durch evidenzbasierte, effiziente und effektive Strategien und Massnahmen zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, fokussiert das Projekt auf fünf Schwerpunkte:
1. Bewertung und Dokumentation der Fischvielfalt, Kartierung der Artenverteilung und Beschreibung neuer Arten
Die Wahrscheinlichkeit den Verlust der Biodiversität stoppen und Lebensräume effektiv schützen zu können, hängt fundamental mit der Fähigkeit zusammen Arten korrekt zu erkennen und die biologische Vielfalt vollumfänglich zu beschreiben. Die Taxonomie spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie sich mit der Erkennung, Beschreibung, Verständnis und Einordnung der biologischen Vielfalt befasst. Rund ein Fünftel der über 120 in der Schweiz vorkommenden Fischarten gehören zu sogenannten Artkomplexen und sind weder formell beschrieben, noch sind ihre Habitatansprüche bekannt. Im Rahmen des LANAT-3-Projekts werden die Artkomplexe der Bartgrundeln (Barbatula spp.), Elritzen (Phoxinus spp.), Groppen (Cottus spp.), Gründlinge (Gobio spp.) und andere untersucht, ihre Identifizierung geklärt und neue Arten beschrieben (Calegari et al. akzeptiert). Die Beschreibung und Benennung dieser Arten ist entscheidend für deren Schutz, denn nur beschriebene Arten können durch die Gesetzgebung geschützt und gezielt gefördert oder in ihrer Verbreitung ausserhalb ihres natürlichen Lebensraums überhaupt dokumentiert werden (Josi et al. 2024a).
2. Identifizierung von Umweltfaktoren, die die Verbreitung von Arten beeinflussen
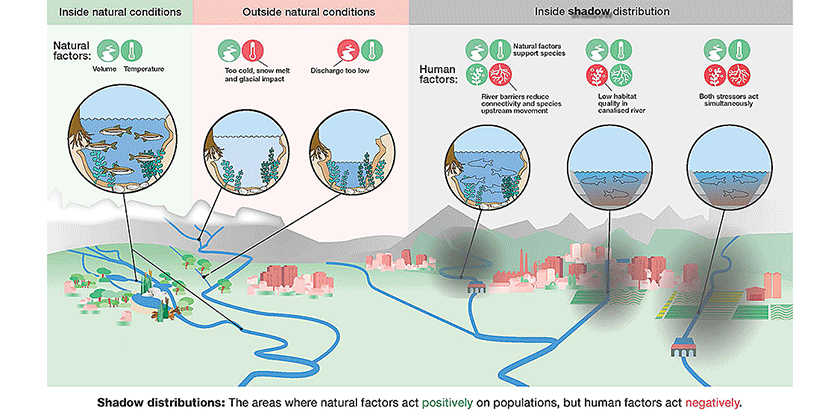
Sowohl natürliche Faktoren wie das Klima und die Verfügbarkeit von Nahrung als auch menschliche Aktivitäten beeinflussen die Verbreitung von Arten. Ökologische Nischenmodelle werden dazu genutzt, um vorherzusagen, wo Arten wahrscheinlich vorkommen. Aber bisher konnten diese Modelle nicht erklären, warum bestimmte Gebiete geeignet sind oder nicht (Josi et al. 2024b). Daher wurde in diesem Projekt ein neuer Ansatz entwickelt, der erklärbare künstliche Intelligenz verwendet, um herauszufinden, welche Umweltfaktoren einen Lebensraum für eine Art an einem bestimmten Ort gut oder schlecht machen. Auf diese Weise lässt sich das Ausmass menschlicher Aktivitäten auf den natürlichen Lebensraum einer Art quantifizieren und die wichtigsten Faktoren ermitteln, die den Verlust von Arten in einem bestimmten Gebiet verursachen (Waldock et al. 2024). Diese Erkenntnisse helfen dabei, gezielte Massnahmen zum Schutz der aquatischen Biodiversität zu entwickeln (Wegscheider et al. 2024).
3. Ermittlung von prioritären Gebieten für den Schutz der Biodiversität oder die Wiederherstellung von Lebensräumen unter Berücksichtigung des Klimawandels

Aufbauend auf den oben genannten Erkenntnissen wird eine systematische Naturschutzplanung entwickelt, um vorrangig zu schützende Gebiete, künftige Klimarefugien und Regionen mit dringendem Renaturierungsgsbedarf zu ermitteln. Basierend auf dieser evidenzbasierten Planung und Priorisierung wurde das Saane-Sense-Einzugsgebiet als eine von vielen Schlüsselregionen in der Schweiz mit hohem Schutzbedarf identifiziert. In dieser Pilotregion zielt das Projekt nun darauf ab, Wissenschaft und Praxis zu verbinden, um evidenzbasierte, effektive und effiziente Empfehlungen zu entwickeln.

4. Analyse der Praktiken und Perspektiven der Akteure
In der Schweiz gibt es verschiedene Gesetze und Verordnungen, entsprechende Vollzugsbereiche und Akteure, die direkt oder indirekt mit der aquatischen Biodiversität und dem Klimawandel verbunden sind. Um gezielte und sinnvolle Beiträge zur Erhaltung und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität leisten zu können, ist es wichtig zu wissen, was bereits geschieht, welche Perspektiven die Akteure einnehmen, wie sie interagieren und wo es Defizite und Chancen geben könnte. Zu diesem Zweck führt das Projekt eine Kontextanalyse und eine sozial-ökologische Netzwerkanalyse in verschiedenen Regionen durch wie der Untere Emme (Zinn et al. 2024) und in der Pilotregion Saane-Sense. Diese helfen dem Projekt zu beurteilen, wie gut Institutionen intern und untereinander zusammenarbeiten, und zeigen Bereiche auf, in denen Verbesserungen möglich sind.
5. Gemeinsames Entwickeln von evidenzbasierten, effektiven und effizienten Strategien und Massnahmen

Obwohl die Schweiz über rechtliche und strategische Rahmenbedingungen für die Erhaltung der aquatischen Biodiversität verfügt, steht ihre Umsetzung vor zahlreichen Herausforderungen. Dazu gehören begrenzte Ressourcen, eher opportunistische als evidenzbasierte Ansätze, Zielkonflikte und eine unzureichende Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren. Um diese Probleme zu überwinden, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sowie die Umsetzung eines adaptiven und integrierten Managements unerlässlich. Dazu werden in partizipativen Prozessen relevante Akteure zusammengebracht, um gemeinsam evidenzbasierte, praktikable Strategien und Massnahmen für die effektive und effiziente Erhaltung und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität in der Schweiz zu identifizieren. Erste Erkenntnisse wurden in der Testregion gewonnen (Aeschlimann et al. 2024a; Aeschlimann et al. 2024b) und werden in der Pilotregion, in der der Schutz- und Wiederherstellungsbedarf besonders hoch ist, weiter vertieft, um schliesslich Erkenntnisse für die ganze Schweiz zu gewinnen.
Publikationen
In press
Calegari, B.B., Freyhof, J., Waldock, C., Wegscheider, B., Rüber, L., Josi, D., et al. (accepted). Two new species of stone loaches of the genus Barbatula (Cypriniformes: Nemacheilidae) from Europe with a neotype designation of B. barbatula (Teleostei: Nemacheilidae). J. Fish Biol.
Wissenschaftliche Publikationen
Andere Publikationen
Medien
Artikel:
Hier lohnt es sich, den Fluss zu beleben
Neue Fischarten in Schweizer Gewässern entdeckt
Zwei neue Fischarten in Schweizer Gewässern entdeckt
Human impact on fish habitats detected with AI
Eine Prioritätenliste für den Schutz der Artenvielfalt
Vorträge:
TV:
RSI: Nuove specie nelle acque svizzere
TeleBielingue: Deux nouvelles espèces de poisson découvertes en Suisse
Radio:
RTN: Deux nouvelles espèces de poissons découvertes en Suisse
Kollaborationen
Schweizerisches Kompetenzzentrum Fischerei SKF

Adrian Aeschlimann
Geschäftsführer SKF

Pia Fehle
wissenschaftliche Mitarbeiterin SKF
 | Lena Witschi Bachelorstudentin E-Mail senden |
 | Joelle Pfäffli |
Alumni
-
Milena de Haan, Masterarbeit mit dem Titel "Disentangling Drivers of Community Structure in Lotic Freshwater Fish Communities in Switzerland", 2024
-
Sophie Moreau, Masterarbeit mit dem Titel "Eutrophication-induced loss of endemic species reduces thermal response diversity in Swiss lake fish communities", 2024
- Anita Schmid, Masterarbeit mit dem Titel "Intraspecific morphological trait variation of riverine fishes in Switzerland", 2024





















